Buchauszug Walt Bogdanich, Michael Forsythe: „Schwarzbuch McKinsey. Die fragwürdigen Praktiken der weltweit führenden Unternehmensberatung“

Walt Bogdanich (Foto: PR/
McKinsey ist überall
Um halb zwei Uhr nachts klingelte das Telefon im Hause Henzler im Villenvorort Grünwald südlich von München. Ein Anruf mitten in der Nacht bringt selten eine willkommene Neuigkeit, und dieser war keine Ausnahme. Herbert Henzlers
Frau nahm den Hörer ab.
»Wir möchten Monsieur Henzler sprechen. Es ist sehr dringend«, sagte eine männliche Stimme mit starkem französischem Akzent. Frau Henzler reichte ihrem Mann den Hörer, der vor gut einem Jahr im Alter von 42 Jahren Chef der deutschen McKinsey-Niederlassung geworden war. »Herr Henzler, hören Sie genau zu. Ich rufe Sie an von der Action Directe. Wir haben Sie auf unserer Liste«, sagte der Mann und teilte Henzler mit, dass er spätestens am 23. Juli ermordet werden solle – der Tag, für den die Henzlers eine Einweihungsparty in ihrem Haus geplant hatten.
Obwohl Attentate auf prominente europäische Politiker und Wirtschaftsführer heutzutage sehr selten sind, kamen sie in den 1970er- und 1980er-Jahren häufig vor. Die Action Directe, eine linksextremistische französische Terrorgruppe, hatte Anfang 1985 einen hohen Beamten des französischen Verteidigungsministeriums ermordet. In Deutschland hatte die Rote Armee Fraktion (RAF) einige Monate zuvor Ernst Zimmermann, einen bekannten deutschen Industriellen, ermordet. Anfang Juli 1986 fiel Karl Heinz Beckurts, ein hochrangiger Siemens-Manager, einem Bombenanschlag zum Opfer, und 1989 wurde Alfred Herrhausen, der Chef der Deutschen Bank, ermordet.
Die Polizei postierte einen VW-Bus mit Einsatzkräften vor Henzlers Haus. McKinseys Head of Operations wurde nach Deutschland geschickt. Henzler bekam einen Fahrer gestellt, und in seinem Garten wurden aus Sicherheitsgründen ein paar
Bäume gefällt. Am Ende stellte sich heraus, dass die Warnung ein übler Scherz gewesen war: Es war ein verärgerter Mitarbeiter – aus McKinseys Druckerei – der angerufen hatte.
Aber Henzler und die Polizei nahmen die Sache ernst, denn der oberste McKinsey-Consultant in Deutschland war genau die Art von Person, die eine solche Gruppe ins Visier nehmen würde. Seit 1964 das erste McKinsey-Büro in Deutschland er-
öffnet worden war, hatte das Bild des McKinsey-Consultants – in Deutschland »Mecki« genannt – Einzug gehalten ins Bewusstsein der Nation und, was noch wichtiger war, in die Chefetagen von Konzernen und die Ministerien der Bundesregierung. Die Deutschen sind von McKinsey dermaßen besessen, wie es die Amerikaner nicht sind. Es gibt sogar ein Theaterstück, das nach der Firma benannt ist. Als Henzler 1984 zum Chef der deutschen Niederlassung berufen wurde, brachte das Manager Magazin eine Titelgeschichte mit seinem Foto und der Schlagzeile: »McKinsey ist überall!«
Und so war es tatsächlich. Der Autor Duff McDonald schrieb in seinem 2013 erschienenen Buch The Firm, dass McKinsey in Deutschland »von allen Ländern, in denen McKinsey aktiv war, die ausgedehnteste Präsenz in Großunternehmen« hatte und zeitweise 27 der 30 größten Unternehmen des Landes beriet. Überall in den Führungsetagen der größten Unternehmen Deutschlands waren McKinsey-Ehemalige zu finden.
Heute, nach fast sechzig Jahren in Deutschland, zeigen interne Unterlagen von McKinsey, dass unter den weltweit umsatzstärksten Klienten der Firma überdurchschnittlich viele deutsche Unternehmen vertreten sind. Zu McKinseys lukrativsten Klienten der vergangenen Jahre zählten die Versicherungskonzerne Allianz und AOK, die Automobilhersteller BMW und Daimler, Deutsche Bank, Deutsche Volkswagen, Telekom, die Einzelhandelskette Metro, der Pharmakonzern
Bayer sowie die Energieversorger E. ON und RWE. Doch McKinseys Reichweite in Deutschland geht weit über die weltbekannten Konzerne des Landes hinaus. Seit der Jahrtausendwende hat die Firma sich zunehmend auf die Beratung von Regierungen in aller Welt konzentriert, und deutsche Ministerien haben sich als besonders lukrative Klienten erwiesen. Und ebenso wie die Arbeit der Firma für Regierungen in den USA, Großbritannien, Saudi-Arabien, Kanada und anderen Ländern umstritten war, haben auch ihre Aktivitäten in Deutschland – vor allem für das Verteidigungsministerium unter Ursula von der Leyen – Kritik hervorgerufen. Ein weiterer wichtiger Klient in den vergangenen Jahren war das Bundesinnenministerium, das von McKinsey zur Durchführung von Asylverfahren beraten wurde und deswegen unter Beschuss geriet.
Es gibt zudem eine weltweite Diaspora deutscher Meckis. Es war das deutsche Büro, von dem aus McKinseys Brasiliengeschäft aufgebaut wurde. Mehrere deutsche Partner waren daran beteiligt, einen großen Teil der umstrittenen Arbeit McKinseys in Südafrika zu managen. In China trugen deutsche Partner maßgeblich dazu bei, McKinseys Niederlassung zu einem Erfolg zu machen, indem sie dort aktive deutsche Konzerne wie Volkswagen berieten. In Großbritannien wurde die Arbeit von McKinsey mit dem Nationalen Gesundheitsdienst NHS jahrelang von einem deutschen Senior Partner beaufsichtigt.
McKinsey mag zwar in Chicago und New York gegründet worden sein, aber die größte Niederlassung der Welt wurde 1990 die deutsche. Deutsche McKinsey-Partner übernahmen die Führung und eröffneten Büros von São Paulo bis Moskau.
Es ist keine Übertreibung zu behaupten, dass McKinsey heute ebenso deutsch wie amerikanisch ist. Bis Henzler 1998 als Chef der deutschen Niederlassung zurücktrat, war diese »zu einem Knotenpunkt der intellektuellen Macht von McKinsey
geworden, einem Innovationsmotor, einem Exporteur von Humankapital an die Niederlassungen in anderen Ländern«, wie es in der internen Firmenchronik heißt.

Forsythe Michael (Foto: PR/)
Henzler war ungewöhnlich lange bei McKinsey. Innerhalb einer Firma, die Wert auf Teamarbeit legt und erwartet, dass individuelle Persönlichkeiten sich den Anforderungen ihrer Klienten (und der Firma selbst) unterordnen, war er eine dominante Persönlichkeit – einer von McKinseys wahren Baronen. In Deutschland herrschte er unangefochten, bis er 2001 die Firma verließ. In jedem Bericht über McKinsey Deutschland muss er gebührend berücksichtigt werden. Aber trotz des überwältigenden Erfolgs der deutschen Niederlassung unter Henzler innerhalb der Firma wurden weder er noch ein anderer deutscher Consultant jemals auf den höchsten Posten der Firma berufen: den globalen Managing Partner. Die vorigen fünf Managing Partner seit 1994 waren ein in Indien geborener Amerikaner, ein Engländer, ein Kanadier, ein Schotte und ab 2021 ein weiterer Amerikaner. Der Grund dafür mag etwas paradox klingen: Ungeachtet der großen Anzahl deutscher Talente in McKinsey-Büros rings um die Welt ist die deutsche Niederlassung bis heute das, was Henzler daraus gemacht hat: ein eigenständiger Machtbereich und eine Welt für sich.
»Ich glaube nicht, dass jemals ein deutscher Partner zum globalen Managing Partner gewählt werden würde, weil er zu engstirnig wäre«, sagte ein McKinsey-Ehemaliger, der sich mit der Politik innerhalb der Firma bestens auskennt. »Das deutsche Büro ist eine Blase.« Und: »Sie mögen es nicht, wenn Outsider sich in ihre Angelegenheiten einmischen.« Aber es war nicht zu vermeiden, dass Außenstehende sich einmischten.
Bevor sie als das öffentliche Gesicht des europäischen Widerstands gegen die russische Aggression in der Ukraine weltbekannt wurde, war Ursula von der Leyen eine deutsche Politikerin, die seit 2005 im Kabinett von Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Reihe von immer wichtigeren Ämtern innehatte, bis sie 2013 schließlich zur Verteidigungsministerin berufen wurde. Sie und ihr Mann Heiko von der Leyen, der einer deutschen Adelsfamilie entstammt, zogen sieben Kinder groß.
Während sie als Arbeitsministerin fungierte, arbeitete sie mit Katrin Suder zusammen, einer McKinsey-Beraterin, die als Senior Partner die Arbeit der Firma mit dem öffentlichen Sektor in Deutschland leitete. Beeindruckt von Suders Fähigkeit, bei
der Digitalisierung der Bundesagentur für Arbeit nützliche Hilfe zu leisten, wollte von der Leyen sie im Verteidigungsministerium vor Ort haben.
Im August 2014 trat Suder eine Position als Staatssekretärin im Verteidigungsministerium an und gab ihre gut dotierte Stelle bei McKinsey auf – Senior Partner verdienen in der Regel weit über eine Million Dollar pro Jahr –, um in die Bürokratie der Bundesregierung einzutreten. Damals wie heute stand die Ukraine ganz oben auf von der Leyens Problemliste: Ein neu erwachendes und aggressiv agierendes Russland hatte gerade die Krim annektiert. Dieser Konflikt und die anhaltenden Kriege in Syrien und Afghanistan machten die eklatante Unzulänglichkeit der deutschen Streitkräfte allzu deutlich. Von der Leyen wollte das Ministerium effizienter gestalten und die Abläufe zur Waffenentwicklung und -beschaffung verbessern. Suder, die in Neuroinformatik promoviert hatte, sollte im Rahmen dieser Initiative ihr ausführendes Organ sein.
Suder fand ihre Arbeit als Rüstungsstaatssekretärin im Wehrressort außerordentlich schwierig – erschwert durch unzureichende und nicht einsatzbereite Ausrüstung sowie behindert durch eine Bürokratie, die noch nicht so recht im digitalen Zeitalter angekommen war. Unter ihrer Verantwortung wurden externe Consultants engagiert, die ihr helfen sollten, die Behörde auf Vordermann zu bringen: McKinsey wurde beauftragt, aber auch andere Unternehmensberatungen. Vor allem einer von ihnen, nämlich Timo Noetzel von Accenture, wurde zum Blitzableiter für Kritik. Er war nicht nur ein ehemaliger McKinsey-Consultant – er hatte die Firma 2015 verlassen –, sondern er und Suder waren auch befreundet: Suder befand sich beispielsweise unter den Gästen, als Noetzels Kinder getauft wurden.
Suder sagte vor einem Untersuchungsausschuss des Bundestags Anfang 2020 aus, sie habe mit der Auswahl von Accenture für den Auftrag nichts zu tun gehabt, und weiter, dass sie und Noetzel nicht über ihre Arbeit sprächen, wenn sie sich privat träfen: Im Laufe ihrer Jahre bei McKinsey habe sie sich angewöhnt, im Freundeskreis nicht über berufliche Angelegenheiten zu reden.
Und es ist in der Tat so, dass neu eingestellte Mitarbeiter von McKinsey angewiesen werden, mit Kollegen beim Mittagessen oder in der Kaffeepause nicht über ihre Arbeit zu sprechen, wenn sie nicht gerade an demselben Projekt arbeiten. Noetzel, ein ehemaliger Reserveoffizier der Bundeswehr, der 2013 zu McKinsey gekommen war, sagte das Gleiche aus: »Mit Frau Suder bin ich befreundet. Auch unsere Familien sind befreundet. Wir sind in einem ähnlichen Alter und haben insbesondere über die Kinder auch privat gemeinsame Interessen.«
Aber natürlich konnten sie im Ministerium über ihre Arbeit sprechen. Manche Beobachter hielten solche Kontakte für fragwürdig: Ein ehemaliger Kollege und Freund Suders aus ihrer Zeit bei McKinsey erhielt große Aufträge aus ihrem Ministerium. Während sie im Verteidigungsministerium von 2014 bis 2018 war, stiegen die jährlich an Accenture gezahlten Honorare von etwa 500.000 Euro auf circa 20 Millionen Euro, laut einem Bericht im Spiegel. Auf dem internen Blog von Accenture prahlte Noetzel mit seinen Beziehungen ins Ministerium.
Die Beziehungen zwischen dem Verteidigungsministerium und McKinsey waren sogar noch enger. Unter Suder wurde auch ein weiterer McKinsey-Berater namens Gundbert Scherf hinzugezogen, um die Optimierung des Beschaffungswesens im Wehrressort zu beaufsichtigen. Scherf nahm im September 2014 seine Arbeit im Ministerium auf, kaum einen Monat nach Suder. In einer anderen Unternehmensberatung, die Aufträge des Verteidigungsministeriums erhielt – LEAD –, fungierte ein ehemaliger Kollege Suders aus dem Berliner McKinsey-Büro namens Oliver Triebel als Topmanager. Suder, Scherf und Triebel kannten sich alle aus ihrer Zeit bei McKinsey.
Was dann als »Berateraffäre« bekannt wurde, machte Ende 2018 Schlagzeilen in deutschen Medien, nachdem ein Prüfbericht über Aufträge des Verteidigungsministeriums durchgesickert war. In diesem hatte der Bundesrechnungshof festgestellt, dass die meisten davon ohne Ausschreibung vergeben worden waren und in vielen Fällen keine ordnungsgemäße
Dokumentation vorlag, die hätte rechtfertigen können, warum der Auftrag erteilt worden war. Nach einigem Wirbel in den Medien wurde ein Untersuchungsausschuss des Bundestags eingesetzt, der über vierzig Zeugen befragte, bis hin zu der kurz zuvor ernannten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Februar 2020.
In dem 745 Seiten starken Bericht des Untersuchungsausschusses wurde kein strafbares Fehlverhalten durch von der Leyen oder Suder festgestellt, aber dennoch war er vernichtend. Unter ihrer Verantwortung waren Vergaberegeln missachtet worden, wodurch die McKinsey-Tochter Orphoz mehrere auf unrechtmäßige Weise freihändig vergebene Aufträge erhalten hatte, wie eine Prüfung ergab. 18 Consultants, die von der Leyen und Suder an Bord geholt hatten, blieben und generierten sogar zusätzliche Arbeit für sich selbst: Teuer bezahlte Berater gingen ab dann bei der Bundeswehr ein und aus. In der Folge entglitt der Führung des BMVg unter Ministerin von der Leyen die Kontrolle über das Heer der beauftragten Berater. Sie agierten selbstständig, führten irgendwann losgelöst von jeglicher amtlichen Kontrolle ein administratives Eigenleben, operierten in Vergabefragen autonom, vermittelten sich gegenseitig lukrative Aufträge und schufen teilweise selbst die Voraussetzungen für Folgeaufträge.
McKinsey ließ durch einen Sprecher mitteilen, dass in dem Bericht an den Bundestag »kein Fehlverhalten« der Firma festgestellt worden sei und der größte Teil der Untersuchung »mit unserer Firma nichts zu tun« habe. Von der Leyen und Suder
wurden um Stellungnahmen angefragt, haben sich dazu aber nicht weiter geäußert.
Externe Berater, die ein sich selbst erhaltendes Auftragsvergabesystem in Ministerien schaffen, sind ein Problem, das es nicht nur in Deutschland gibt. McKinsey und andere Unternehmensberatungen haben in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada und anderen hochentwickelten Industrieländern über Staatsaufträge viele Milliarden Dollar eingenommen.
Aber von der Leyens Beziehungen zu McKinsey gehen noch weiter und sind viel persönlicher als der Umstand, dass sie Suder eingestellt hat: Während sie als Verteidigungsministerin fungierte, waren zwei ihrer Sprösslinge für McKinsey tätig.
Ihr Sohn David nahm laut seinem LinkedIn-Profil 2015 einen Sommerjob als Associate in McKinseys Büro in Palo Alto im kalifornischen Silicon Valley an und wurde im darauffolgenden Jahr in demselben Büro eingestellt, wo er sich auf Jobs in den Bereichen Technologie, Medien und Unterhaltung konzentrierte. Dass er eingestellt wurde, sorgte bei McKinsey für Irritationen, aber eine mit dem Vorgang vertraute Person sagte, dass es dabei formal korrekt zugegangen sei, weil er für den Job ausreichend qualifiziert war und Einstellungsentscheidungen von den jeweiligen Büros selbst getroffen werden. »Wer in Palo Alto kennt denn schon den Namen der deutschen Verteidigungsministerin?«, sagte diese Person.
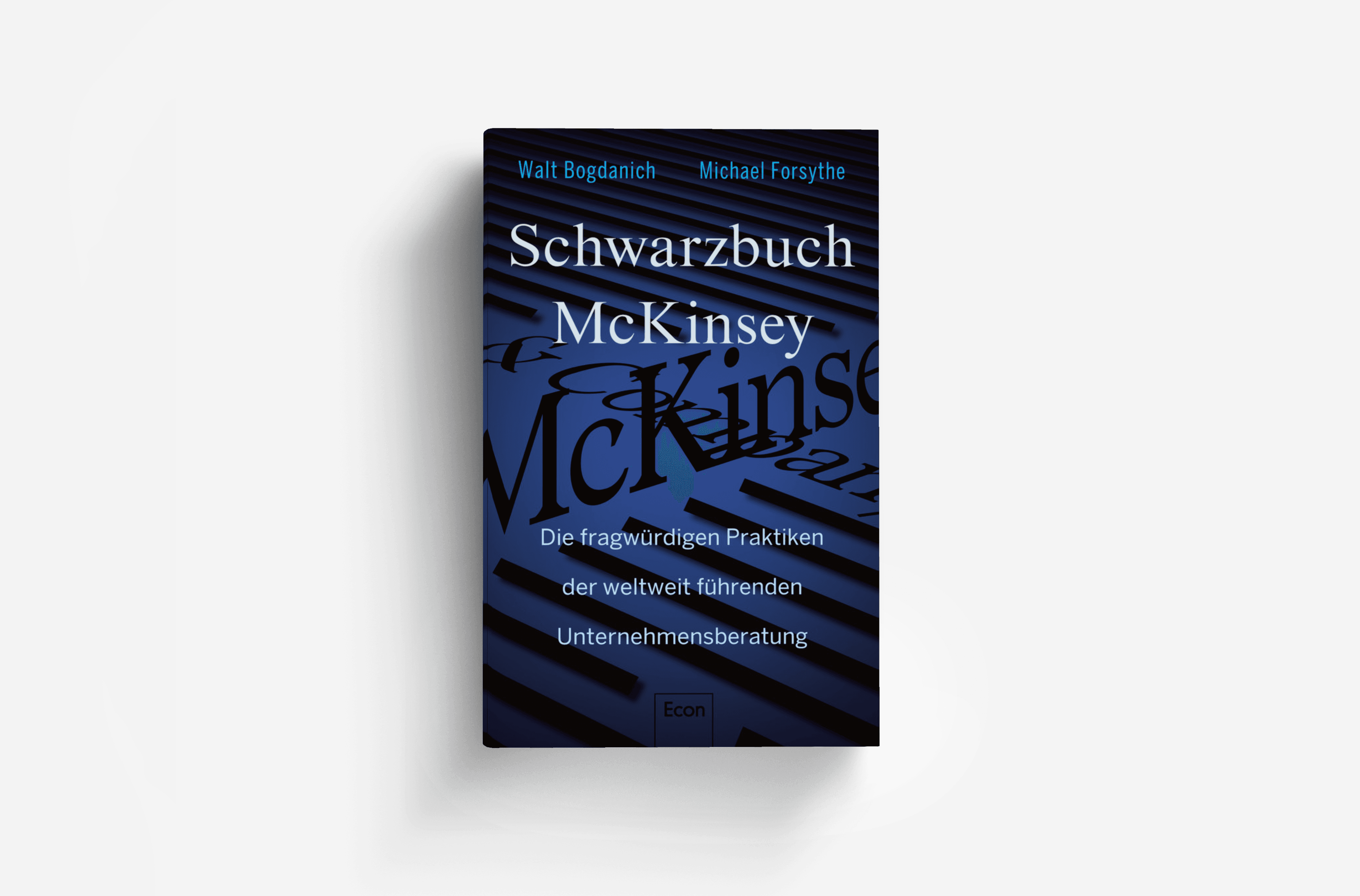
Laut ihrem LinkedIn-Profil begann Tochter Johanna im Oktober 2017 bei McKinsey als »Sustainability Consultant« zu arbeiten. Ihr Name taucht in einem McKinsey-Bericht über die europäische Autoindustrie vom Januar 2019 auf sowie in weiteren Berichten aus dem Jahr 2020 über den Klimawandel. Zu diesem Zeitpunkt hatte ihre Mutter das Bundesverteidigungsministerium bereits verlassen, um ihren EU-Posten als Kommissionspräsidentin in Brüssel zu übernehmen. Im Jahr 2020 wurde Johanna von der Leyen auch als Consultant im Berliner McKinsey-Büro ausgewiesen, wo wohl die meisten genau wussten, welcher Familie die junge Frau mit dem aristokratischen Namen angehört.
Für viele Mitglieder der wirtschaftlichen und politischen Eliten, die sich alljährlich auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos versammeln – und zu denen Ursula von der Leyen natürlich zählt –, gilt McKinsey als eine Art »Eliteinternat« für ihre Sprösslinge, das ihnen die Möglichkeit bietet, sich mit der Businesswelt vertraut zu machen, nachdem sie einen Abschluss an einer prestigeträchtigen Universität absolviert haben. Die Liste von Politikern und Topmanagern, deren Kinder in die Reihen der McKinsey-Consultants aufgenommen wurden, ist lang.
Die bekannteste von ihnen dürfte Chelsea Clinton sein, die Tochter von Bill und Hillary Clinton. In Frankreich ist Victor Fabius zu nennen, der Sohn des ehemaligen französischen Außenministers und Premierministers Laurent Fabius. Mehrere Abkömmlinge saudischer Minister haben bei McKinsey gearbeitet, ebenso eine lange Reihe von Nachkommen der CEOs einiger der größten Unternehmen der Welt, darunter zwei Töchter von Carlos Ghosn, dem langjährigen CEO von Nissan, die Tochter von Bernard Arnault, dem CEO von LVMH, sowie die Tochter des indischen Milliardärs Mukesh Ambani.
Laut einem ehemaligen McKinsey-Mitarbeiter, der sich mit dem Einstellungsverfahren der Firma auskennt, werden die Söhne und Töchter der Reichen und Mächtigen offiziell wie alle anderen Bewerber behandelt – es gibt keine Sonderbehandlung für sie. Wenn aber jemand abgelehnt wird, so diese Person, »kann derjenige, der für den betreffenden Kunden zuständig ist, sagen: ›Hey, könnt ihr euch das nicht noch mal ansehen?‹«
Diese Person sagte auch, es sei unwahrscheinlich, dass die Einstellung der Kinder durch McKinsey einen Einfluss auf die Auftragsvergabe durch das Ministerium hatte – und sei es nur, weil Katrin Suder, einer der ranghöchsten deutschen McKinsey-Partner, unter von der Leyen einen Großteil des Beschaffungswesens im Wehrressort des Verteidigungsministeriums leitete. »Katrin wurde auf einen Posten gesetzt, auf dem sie immer wieder McKinsey beauftragen konnte«, sagte die Person. »Wenn man so jemanden hat, wer braucht dann noch die Kinder?« »Wir wenden ein stringentes und objektives Einstellungsverfahren an, das alle Kandidaten durchlaufen müssen, die sich bei unserer Firma bewerben«, sagte dazu ein Sprecher von McKinsey.
Bei ihrer Aussage vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestags im Februar 2020 verteidigte von der Leyen Suder und sagte, sie habe ihre Arbeit »mit großer Bravour gemeistert«. Auch sich selbst stellte von der Leyen ein gutes Zeugnis aus, räumte aber ein: »Natürlich haben wir dabei auch Fehler gemacht, es gab Vergabeverstöße, unklare Einbettungen Dritter.« Ein Sprecher der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte, die Unterlagen würden zeigen, dass »Frau von der Leyen an keiner einzigen Vergabeentscheidung an irgendeine Firma beteiligt war. Dem ist nichts hinzuzufügen.«
Als es um McKinsey ging, beantwortete sie die Frage des Untersuchungsausschusses, ob sie über das Geflecht von persönlichen und geschäftlichen Beziehungen Suders zu der Firma informiert gewesen sei, mit dieser Aussage: »Ich habe gewusst, dass sie von McKinsey kommt, und damit wusste ich, dass sie da transparent sein wird.«
Zwei Jahrzehnte nach Beginn dieses Jahrhunderts ist McKinsey – und sein Heer von Ehemaligen – überall in Deutschland präsent. Doch vor fast sechzig Jahren wurde McKinseys Einstieg in Deutschland fast zu einer Fehlgeburt, als die Firma 1964 ihr erstes deutsches Büro in Düsseldorf in der Königsallee 98 eröffnete. Manche Beobachter hatten den Eindruck, die sehr amerikanische Firma McKinsey würde nicht so recht nach Deutschland passen. Damals hatte McKinsey nur drei Klienten in Deutschland: Dynamit Nobel, Standard Elektrik Lorenz und Volkswagen.
Die Deutsche Shell sollte bald folgen. Das deutsche Wirtschaftswunder war in vollem Gang. Den westdeutschen Unternehmen ging es gut – wofür sollte man einen Unternehmensberater engagieren? Was war ein Unternehmensberater überhaupt?
Der McKinsey-Consultant Logan Cheek, der 1968 zu McKinsey kam, berichtete, dass seinerzeit in Deutschland noch kein Mensch etwas von Unternehmensberatung gehört hatte: »Die Deutschen konnten nicht verstehen, warum ein Mensch in einer führenden Position jemand anders dafür bezahlen sollte, dass er ihm sagt, was er tun soll.« Viele Deutsche dachten, McKinsey habe etwas mit dem Sexualforscher Alfred E. Kinsey zu tun, erklärt Cheek.
Henzler, der 1970 zu McKinsey kam, nachdem er an der University of California in Berkeley in Wirtschaftswissenschaften promoviert hatte, sagte über die Anfangsjahre der Firma in Deutschland: »In den Großunternehmen herrschten Vorstände, die das Wirtschaftswunder sich selbst zuschrieben, und für Beratung sahen viele keinen Bedarf.« Erschwerend kam hinzu, dass McKinseys Vorzeigeprodukt in Europa, nämlich die Beratung von Unternehmen bei der Umsetzung des multidivisionalen Unternehmensmodells, das in den USA zuerst bei Großkonzernen wie General Motors und General Electric eingeführt worden war, allmählich in die Jahre kam. Viele Unternehmen hatten die entsprechende Organisationsstruktur »M-Form« entweder schon eingeführt oder inzwischen genug davon. Henzler hat das Modell einmal
mit einer Frau verglichen, die ein schönes Kleid kauft, um in die Oper zu gehen: Nachdem sie es gekauft hat, braucht sie viele Jahre lang kein neues mehr zu kaufen. So war es auch mit der M-Form. »Kommen Sie in zwei Jahren wieder, dann wer-
den wir vielleicht etwas Neues brauchen.«
Dann war da noch die Notwendigkeit, sich an die deutsche Unternehmenskultur anzupassen, die sich deutlich vom anglo-amerikanischen Modell unterscheidet. Marvin Bower, der langjährige Managing Partner von McKinsey, der die Firma nach dem Tod ihres Gründers James O. McKinsey im Jahr 1937 zu einem globalen Powerhouse aufbaute, sagte: Eines der Hindernisse sei die in Deutschland vorgeschriebene duale Führungsstruktur mit Vorstand und Aufsichtsrat gewesen, die völlig anders sei als in den USA, und ein Gefühl von »gemeinschaftlicher statt individueller Verantwortung«. Und die deutschen Kunden seien ganz einfach sehr anspruchsvoll, fügte Bower hinzu.
Laut Bower hatten sie nicht nur »ein Interesse an, sondern einen fast unstillbaren Wissensdrang nach den Details und der Logik, die unseren grundlegenden Empfehlungen zugrunde liegen«, so Bower. »Die Kunden wollten genau wissen, wie die Analysen erstellt und die Schlussfolgerungen gezogen werden.« Mit beinahe britischem Understatement fügte der Amerikaner Bower hinzu: »Wir gewöhnten uns bald an die deutschen Gepflogenheiten.« Das Wirtschaftswunder in Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg hatte bei den führenden einheimischen Industrieunternehmen, die zusammen unter dem Namen »Deutschland AG« bekannt waren, eine gewisse Selbstzufriedenheit erzeugt. Sie konzentrierten sich vor allem anderen auf die Produktion, und laut Henzler sagten sie dann einfach dem Vertrieb, er solle »sehen, wie er es verkauft«.
Doch ab den 1970er-Jahren bedeutete die wachsende globale Konkurrenz, vor allem aus Japan, dass die deutschen Unternehmen sich dem Wandel der Zeit anpassen mussten. Japan griff Deutschland in zentralen Industriezweigen an und baute hochwertige Autos, Kameras und Unterhaltungselektronik. Das war eine Chance für McKinsey, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Rückblickend ist leicht zu erkennen, warum McKinsey in Deutschland so erfolgreich war. Ebenso wie in Großbritannien – einem weiteren Land, in dem McKinsey tiefe Wurzeln geschlagen hat – gibt es auch unter den Eliten in Deutschland ein gewisses Maß an Vereinsmeierei. Sobald einer von ihnen eine Person in den Verein aufnimmt, spricht sich das herum. In Deutschland sitzen zahlreiche Vorstandsvorsitzende in den Aufsichtsräten anderer Firmen, sodass solche Neuigkeiten sich besonders schnell herumsprechen können.
Schon vor Beginn der 1970er-Jahre hatte McKinsey mit einigen der größten deutschen Unternehmen zusammengearbeitet, zum Beispiel mit Volkswagen. Doch feste Engagements, die regelmäßig hohe Beraterhonorare einbrachten und ganze
Heerscharen junger McKinsey-Consultants beschäftigten, waren nur von kurzer Dauer. Der VW-Konzern, der McKinsey für mehrere Projekte engagiert hatte – so zum Beispiel auch für eine Studie, um ein Nachfolgemodell für den Käfer zu finden –, beendete damals die Zusammenarbeit 1971.
McKinsey brauchte einen Zugang zu einem bedeutenden Unternehmen mit enormem Einfluss in der deutschen Wirtschaftselite, zu dem es eine langfristige Beziehung aufbauen konnte. Die Unternehmensberatung brauchte einen Mäzen, und 1974 fand sie einen: Siemens. Siemens, der traditionsreiche deutsche Mischkonzern, der in diversen Produktionszweigen – von Eisenbahnzügen bis hin zu medizinischem Gerät – seine Finger im Spiel hat, war so etwas wie General Electric in den USA. Henzler stieg 1974 bei McKinsey ein, und so begann eine Arbeitsbeziehung, die 27 Jahre ununterbrochen anhielt, bis er die Unternehmensberatung verließ. Siemens festigte Henzlers Stellung bei McKinsey. Innerhalb weniger Monate wurde er zum Partner
berufen und schon vier Jahre darauf zum Direktor (heute Senior Partner genannt).
Es macht sich gut im Storytelling, den Aufstieg eines Menschen als unerwartet oder unwahrscheinlich darzustellen, aber bei Henzler war es nicht so. Seine Doktorarbeit an der University of California in Berkeley drehte sich um statistische Verfahren, und dieser analytische Hintergrund kam ihm bei McKinsey zugute.
Wie bei vielen Deutschen, die während des Zweiten Weltkriegs geboren wurden, war seine frühe Kindheit alles andere als sorglos. Er stammte aus bescheidenen Verhältnissen in einer ländlichen Region südlich von Frankfurt am Main. Im Krieg hatte sein Vater als Soldat beim Bodenpersonal der Luftwaffe gedient. Nach der Heimkehr des Vaters fiel es der Familie schwer, auf ihrem Bauernhof über die Runden zu kommen. Als kleiner Junge verbrachte Henzler einige Zeit in einem Sanatorium, da bei ihm Tuberkulose diagnostiziert worden war. Doch bis er zum Teenager herangewachsen war, bot die boomende Wirtschaft Westdeutschlands jede Menge Gelegenheiten für einen klugen und fleißigen jungen Mann. Er bekam eine Lehrstelle bei der Deutschen Shell und dann einen Job als Handelsvertreter. Anschließend studierte er Wirtschaftswissenschaften an der Universität Saarbrücken und wurde
schließlich in Berkeley angenommen. Nach seiner Promotion hätte er in McKinseys Büro in San Francisco anfangen können, doch 1970 entschied er sich, ein Angebot von McKinsey Deutschland anzunehmen.
Im Jahr 1974 – einer Zeit, in der die Konjunktur nicht durch Streiks ausgebremst wurde, sondern dadurch, dass die westdeutsche Mannschaft auf dem besten Weg war, die Fußballweltmeisterschaft zu gewinnen – begann Henzler, an der Studie »Siemens 01« zu arbeiten, die dem Ziel diente, die Effizienz in einem Werk zu verbessern, das Produkte wie elektrische Schalter und Steckdosen herstellte. Der Erfolg dabei führte zu weiteren Projekten für Siemens, darunter in den 1980er-Jahren eine große Untersuchung, um herauszufinden, wie Siemens der Herausforderung durch Japan begegnen konnte, dessen Fabriken Produkte wie Telekommunikationsgeräte typischerweise um 30 bis 40 Prozent billiger produzierten als in Deutschland. 36
McKinsey war so sehr in der Zusammenarbeit mit Siemens engagiert, dass zeitweise ein Sechstel der Associates des deutschen McKinsey-Büros dort arbeiteten, was Siemens laut Henzler zu dem mit Abstand größten Klienten der Firma in Deutschland machte. Das führte dazu, dass McKinsey von Siemens abhängig wurde und anfällig für die Folgen eines jeden Fehlers.
In einem speziellen Fall wurde ein in Großbritannien ansässiger McKinsey-Consultant in einer britischen Zeitung mit einer Äußerung zitiert, die einer Siemens-Initiative zuwiderlief und damit die gesamte Arbeit von McKinsey bei dem deutschen Konzern gefährdete. »Wenn Siemens nichts mit uns zu tun haben wollte, würden uns womöglich auch andere meiden«, erinnerte sich Henzler. Henzler engagierte sich so intensiv für Siemens, dass er 1976 auf einer Versammlung von McKinsey-Partnern auf den Bahamas die Konkurrenz zwischen Siemens und dem französischen Elektrotechnikkonzern Schneider Electric unter Bezug auf die Kriegstheorie des preußischen Militärtheoretikers Carl von Clausewitz beschrieb. Nur drei Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und angesichts der Tatsache, dass viele
leitende McKinsey-Consultants im Krieg gedient hatten, kam das nicht gut an. Er musste sich abfällige Bemerkungen anhören – »Die Deutschen ändern sich wohl nie« – und nannte die ganze Episode ein »Fiasko«.
Es kann gut sein, dass Henzler mit seiner Direktheit – selbst in der offiziellen McKinsey-Firmenchronik wird er als »willensstark, dominant und darauf bedacht, seine Unabhängigkeit zu wahren« beschrieben – über kurz oder lang so viele seiner Kollegen verärgert hatte, dass jede Chance verspielt war, am Ende den wichtigsten globalen Topjob der Firma zu übernehmen: den des Managing Partners. Aber während McKinsey in Deutschland weiter expandierte, lieferte Henzler zweifellos gute Gründe, ihn dafür zumindest in Betracht zu ziehen. 1985 trat er die Nachfolge des britischen Senior Partners John McDonald an, der die deutsche Niederlassung in
den ersten zwei Jahrzehnten ihres Bestehens geführt hatte.
Wie Großbritannien wurde auch Deutschland über einen großen Teil der 1980er-Jahre von einer konservativen Partei geführt, der Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU) unter Bundeskanzler Helmut Kohl, der eine stärker
marktwirtschaftliche Orientierung der deutschen Politik anstrebte.
Das war Musik in Henzlers Ohren. In dem Land, das Karl Marx und Friedrich Engels hervorgebracht hatte, einem Land, in dem die Arbeiterschaft so stark in den Vorständen von Unternehmen vertreten ist, wie es in der angloamerikanischen Welt nicht üblich ist, war Henzler ein Jünger eines Vordenkers des Kapitalismus: Adam Smith. Henzler führt die Philosophie des schottischen Ökonomen aus dem 18. Jahrhundert an erster Stelle in seinem analytischen »Werkzeugkasten« auf, den er einsetzt, um die Probleme von Unternehmen zu analysieren.
»Der freie Markt erbringt die besten Ergebnisse – alles, was den freien Markt hemmt, schadet der Volkswirtschaft«, schrieb er in seinem Buch. Smiths Idee, die Effizienz zu maximieren, half Henzler, seine Ansichten über die Vorteile des Outsourcings von Dienstleistungen oder Prozessen, die anderswo effizienter durchgeführt werden können, zu entwickeln. Ein weiteres Tool in Henzlers Werkzeugkasten war das Werk von Adam Smiths philosophischem Cousin David Ricardo, dessen Theorie des komparativen Vorteils zwischen Nationen sich laut Henzler »heute wie ein frühes Manifest zur Globalisierung« liest. Henzler zitierte den 1823 verstorbenen britischen Ökonomen, der den analytischen Rahmen lieferte, der zeigt, warum eine DDR-Mikrochipfabrik es nach dem Mauerfall 1989 verdiente, auf dem Müllhaufen der Geschichte entsorgt zu werden.
Henzler, ein typischer Repräsentant der Rolle McKinseys als Berater und Consigliere in den Chefetagen von Konzernen, verabscheute die deutsche Rechtslage, nach der auch Vertreter der Belegschaft Sitze im Vorstand von Unternehmen bekommen müssen. Die Tatsache, dass Bundeskanzler Willy Brandt 1972 gegen diverse Widerstände ein Gesetz über die paritätische Mitbestimmung durch den Bundestag brachte, kommentierte Henzler so: »Es war ein deutscher Sonderweg, denn kein anderes Land auf der ganzen Welt erwog auch nur, die Unternehmensführung derart zu erschweren.«
In den 1980er- und 1990er-Jahren lag in Deutschland ebenso wie in Thatchers Großbritannien die Privatisierung von Staatsunternehmen in der Luft. Wie im Vereinigten Königreich beriet McKinsey auch in Deutschland die Regierung bei der Pri-vatisierung einiger ihrer wichtigsten Unternehmen, darunter die Deutsche Telekom und die Deutsche Bundespost. Nach wie vor vertiefte die Firma ihre Geschäftsbeziehungen zu Deutschlands größten Unternehmen und beriet etwa die Deutsche Bank bei ihrer Expansion auf die internationalen Finanzmärkte, die daraufhin zum Beispiel die Londoner Investmentbank Morgan Grenfell und das New Yorker Geldhaus Bankers Trust kaufte. Im Jahr 1987 sagte Edzard Reuter, der damalige Vorstandsvorsitzende von Daimler-Benz: »In Deutschland geschieht nichts, ohne dass McKinsey vorher konsultiert wird.«
Spätestens um 1992 herum hatte die deutsche McKinsey-Niederlassung das New Yorker Büro nicht nur eingeholt, sondern war nach Henzlers Einschätzung um etwa 25 Prozent größer. Und McKinsey nahm eines seiner bis dahin wichtigsten Projekte in Deutschland in Angriff: die Umstrukturierung der ostdeutschen Wirtschaft nach der Wiedervereinigung. McKinsey beriet die Treuhandanstalt, die für die Umstrukturierung ostdeutscher Betriebe federführend verantwortlich war, mit einem Team von dreißig Consultants. Es war ein unglaublich bedeutender Auftrag. Henzler beschreibt es so: »Ich gehörte zu den Beratern der ersten Stunde, die bei den Entscheidungen halfen: Welche Betriebe müssen abgewickelt, welche saniert werden und welche lassen sich gleich an private Investoren verkaufen?«
Doch so wichtig diese Arbeit auch war, so sehr erregte McKinseys Rolle doch unerwünschte Aufmerksamkeit, als zwei Partner versuchten, Anteile an einem ostdeutschen Betrieb von der Treuhand zu kaufen: Beide wurden daraufhin gefeuert.
Ein Zeichen für die wachsende Bedeutung McKinseys in der deutschen Wirtschaft war, dass einige Alumni der Firma – ehemalige McKinsey-Consultants – führende Positionen in deutschen Topunternehmen übernahmen – ganz so, wie es zuvor in den Vereinigten Staaten und Großbritannien geschehen war: Helmut Panke, der bis 1982 bei McKinsey war, wurde CEO von BMW. Klaus Zumwinkel, der 1974 bei McKinsey angefangen hatte, wurde Chef der Deutschen Post. Werner Seifert übernahm die Leitung der Deutschen Börse, während sie die Übernahme von Börsen in anderen Ländern in die Wege leitete. Friedrich Schiefer übernahm einen führenden Posten in der Finanzabteilung des Versicherungskonzerns Allianz, einem wichtigen McKinsey-Kunden. Und die Treuhandanstalt stellte den McKinsey-Consultant Ken-Peter Paulin als Leiter des Direktorats Sanierung ein.
Der deutsche Beraterstab von McKinsey machte nicht nur in Deutschland, sondern weltweit Eindruck. Entgegen der Anweisung der McKinsey-Zentrale gründete die deutsche Niederlassung ein Büro in São Paulo, um Daimler-Benz und andere
deutsche Konzerne bei ihren Unternehmungen in Brasilien zu beraten. Deutsche McKinsey-Partner waren auch daran beteiligt, Büros im postkommunistischen Osteuropa aufzubauen, in Städten wie Budapest, Prag und Moskau. »Überall starteten wir mit einem Kernteam, das wir um einen deutschen Partner herum bildeten und mit Beratern verstärkten, die die Landessprache beherrschten«, schrieb Henzler und fügte hinzu: »Die deutsche Variante innerhalb von McKinsey wurde immer dominanter, und ich ertrug es gern, dass man damals bei McKinsey von ›Herb the founder‹ sprach.« Spätestens 1998 arbeitete jeder fünfte McKinsey-Consultant weltweit in einem deutschen Büro der Firma.
Die deutsche McKinsey-Niederlassung bewahrte sich ihren weltumspannenden Einfluss auch dann noch, als Henzler 1998 als ihr Chef zurückgetreten war und 2001 McKinsey ganz verlassen hatte. Deutsche Kunden wie zum Beispiel Volkswagen brachten den McKinsey-Büros in Peking und Schanghai wichtige Aufträge. Die McKinsey-Büros in Südafrika waren überwiegend mit deutschen Partnern besetzt. Südafrika war ein beliebtes Einsatzland für Consultants der deutschen Niederlassung: Für Partner, die über eine Million Dollar im Jahr verdienten, bedeuteten die niedrigen Lebenshaltungskosten des Landes, dass sie in einem wesentlich luxuriöseren Stil leben konnten als im eigenen Land.
Die Alumni der mächtigen deutschen McKinsey-Niederlassung sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Henzler, so bekannt er auch sein mag, ist vermutlich nicht der berühmteste Ehemalige. Diese Ehre – zumindest als die infamste Person, die
jemals in Deutschland für McKinsey gearbeitet hat – dürfte Ruja Ignatova zuteilwerden, die es bis zum Associate Partner gebracht hatte, bevor sie 2009 McKinsey verließ. Im Jahr 2014 gründete Ignatova die Kryptowährung OneCoin. Ihre McKinsey-Karriere – und, wie ein McKinsey-Veteran sagt, die geschäftlichen Beziehungen, die sie in der Firma knüpfte – trugen dazu bei, dass es ihr gelang, etliche Milliarden Dollar von Investoren in eine Konstruktion zu locken, die sich später als mutmaßliches Schneeballsystem herausstellte.
Im August 2022 gehörte Ignatova zu den zehn meistgesuchten Personen auf der Fahndungsliste des amerikanischen FBI, das eine Belohnung von 100.000 Dollar für Hinweise ausgesetzt hat, die zu ihrer Verhaftung führen. Sie wird unter anderem wegen »Wire Fraud« (Betrug unter Einsatz von Telekommunikationsmitteln gemäß US-Recht) und Anlagebetrug gesucht. Ignatovas Verschwinden im Jahr 2017 und das Auffliegen der mutmaßlichen Ponzi-Betrugsmasche alarmierten die deutsche McKinsey-Niederlassung, die sich von der Dame distanzieren wollte. Aber es war schwierig, ihre Online-Präsenz bei der Firma zu löschen; unter anderem zählte sie zu den Autoren eines Berichts über das Firmenkundengeschäft im osteuropäischen Bankensystem, den McKinsey 2009 veröffentlicht hatte.
»Die Anschuldigungen gegen diese Person haben nichts mit McKinsey zu tun, und es wäre irreführend, etwas anderes zu behaupten«, sagte ein Sprecher von McKinsey dazu. In Deutschland selbst war es die McKinsey-Niederlassung, die der Regierung half, die Asylverfahren des Landes zu beschleunigen. McKinsey-Consultants halfen dabei, die Bearbeitungszeit zu verkürzen, das Verfahren zu digitalisieren, es zu optimieren und so den massiven Rückstand bei der Bearbeitung von Asylanträgen aufzuarbeiten, der bis 2015 auf mehrere Hunderttausend Fälle angewachsen war. Doch die verbesserte Effizienz hatte einen hohen Preis: Bevor McKinsey das System änderte, hatten die Fallbearbeiter jeden Asylbewerber angehört und befragt. Im neuen System war das nicht mehr vorgesehen, da die Rechte des einzelnen Antragstellers und die fachliche Schulung der Entscheider der Notwendigkeit geopfert wurden, Anträge schneller zu bearbeiten. Das neue Verfahren wurde als »Integriertes Flüchtlingsmanagement« bezeichnet. Manche Flüchtlinge, die auf keinen Fall hätten Asyl erhalten dürfen, durften im Land bleiben, und andere, die es verdient hätten, wurden ausgewiesen, hieß es in einem Bericht der Zeit.
Ein Zeichen dafür, wie weit McKinseys Beziehungen in die Bundesregierung reichten und dass sie einer Drehtür glichen, ist der Umstand, dass der Beamte, den die Regierung unter Bundeskanzlerin Merkel mit der Optimierung des Asylverfahrens beauftragte, Frank-Jürgen Weise war. Früher, als Ursula von der Leyen noch als Arbeitsministerin fungierte, hatte er bei der Modernisierung der Bundesagentur für Arbeit McKinsey hinzugezogen. Und die Person, die McKinsey bei dem
Job für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ( BAMF) als Star-Beraterin vorschickte, war niemand anders als Katrin Suder. Ein McKinsey-Sprecher sagte dazu, dass die Firma diese Arbeit »auf Anweisung von Regierungsbeamten« durchführe. »Bei diesen und anderen Projekten im öffentlichen Sektor versucht McKinsey, den Klienten des öffentlichen Sektors zu helfen, ihre Abläufe zu verbessern.«
McKinseys weitreichende Präsenz in Deutschland hat ein hohes Maß an Selbstreflexion ausgelöst. Wie kommt es, dass die Firma, deren Senior Partner sich Kapitalismus, freie Marktwirtschaft und freien Handel auf die Fahnen geschrieben haben, in Deutschland – einem Land mit hohen Steuern, großzügigen Sozialleistungen und einem hochentwickelten System von Gewerkschaften – so erfolgreich ist? Und was sagt das über die deutsche Gesellschaft aus?
Der deutsche Schriftsteller und Dramatiker Rolf Hochhuth hat 2004 versucht, diese Frage in seinem Theaterstück McKinsey kommt aufzugreifen. In dem Drama standen nicht die Details von McKinseys Aktivitäten in Deutschland im Mittelpunkt, sondern das Wesen der Zusammenarbeit der Firma mit führenden deutschen Unternehmen. In einem Akt des Stücks geht es um die Deutsche Bank, die trotz enormer und immer
weiter steigender Gewinne Stellen kürzt. Das Theaterstück wurde verrissen und war umstritten. Dass aber McKinsey schon im Titel genannt wird, deutet an, welchen Einfluss die Firma auf die deutsche Seele hat.
Der Eindruck, dass von McKinseys sechzig Jahre langer Präsenz in Deutschland hauptsächlich die Empfehlung in Erinnerung bleibt, Stellen zu kürzen – ein Vorwurf, der McKinsey in der Presse oft gemacht wird –, trifft bei Henzler anscheinend einen wunden Punkt. »Dieses Klischee wurde und wird McKinsey gern angeklebt, um einen Prügelknaben zu markieren, wenn Betriebe und Konzerne sich veränderten Marktbedingungen anpassen und dabei zwangsläufig Arbeitsplätze streichen«, so Henzler. Für Henzler sind Stellenkürzungen manchmal die einzige Möglichkeit, um Arbeitsplätze zu erhalten: »In bestehenden, besonders reifen Geschäftsfeldern der Industrie ist die Reduzierung von Arbeit durch rationellere Fertigungsverfahren die einzige nennenswerte Methode. Wer dabei Ratschläge gibt, hilft, die Zukunft der Unternehmen zu sichern und damit Arbeitsplätze zu erhalten.«
Viele Jahre nachdem er McKinsey verlassen hatte, blickte dieser Jünger von Adam Smith und David Ricardo auf das Deutschland des 21. Jahrhunderts, das er mitgestaltet hatte, und sah, wie ungezügelter Kapitalismus begann, das gesellschaftliche Gewebe zu zerreißen. Im letzten Kapitel seiner Autobiografie sinnierte er über die seiner Meinung nach wachsende Einkommensungleichheit in Deutschland und die
zunehmende Zahl von Zeitarbeitskräften, die womöglich nicht in der Lage sein werden, mit einer ausreichenden Rente in den Ruhestand zu gehen. »Das alles sind Dinge, die nicht mehr stimmen«, schrieb er.
Sosehr McKinsey geholfen haben mag, die Gewinne deutscher Industrieunternehmen zu steigern, hat doch die Vorgehensweise der Firma auch vernichtende Kritik hervorgerufen. In der deutschen Presse wurde McKinsey als »eiskalte Elite«,
»Hohepriester des Kapitalismus« und »Jesuiten der deutschen Wirtschaft« bezeichnet. Henzler spielt das herunter und wiederholt einen Witz, der damals, als er seine vorgetäuschte Morddrohung erhielt, die Runde machte: »Was ist der Unterschied zwischen der RAF und McKinsey?« Antwort: »Die RAF hat Sympathisanten.«
Copyright: @Claudia Tödtmann. Alle Rechte vorbehalten.
Kontakt für Nutzungsrechte: claudia.toedtmann@wiwo.de
Alle inhaltlichen Rechte des Management-Blogs von Claudia Tödtmann liegen bei der Blog-Inhaberin. Jegliche Nutzung der Inhalte bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung.
Um den Lesefluss nicht zu behindern, wird in Management-Blog-Texten nur die männliche Form genannt, aber immer sind die weibliche und andere Formen gleichermaßen mit gemeint.



